© Getty Images/iStockphoto/ andresr

Über uns
Für ein modernes Gesundheitssystem
Warum ist es so schwierig, einen Arzttermin zu bekommen? Warum finden kleinere Behandlungen so oft im Krankenhaus statt? Warum wird das Pflegepersonal nicht stärker entlastet? Und warum gibt es oft keine digitalen Alternativen zum Papierweg?
Fortschrittliche Akteure haben sich bereits auf den Weg gemacht, Probleme im Gesundheitswesen anzupacken. Hier berichten wir über Vorzeigeprojekte und innovative Impulse für das Gesundheitssystem.
Mehr lesen
Fortschrittliche Akteure haben sich bereits auf den Weg gemacht, Probleme im Gesundheitswesen anzupacken. Hier berichten wir über Vorzeigeprojekte und innovative Impulse für das Gesundheitssystem.
NEUESTE ARTIKEL
© Uwe/Vadim - stock.adobe.com
Versorgungsstrukturen patientenorientiert gestalten
Zusammenarbeit neu denken: Dr. Bernhard Gibis im Interview
15 Apr 2024
Dr. Johannes Leinert
© j-mel - stock.adobe.com

Digitale Transformation im Gesundheitswesen
Potenziale für ein lernendes Gesundheitssystem: Maro Bader im Interview
12 Mrz 2024
Jörg Artmann
Vladyslav Bashutskyy @ stock.adobe.com
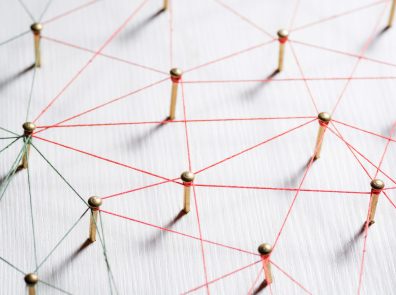
Versorgungsstrukturen patientenorientiert gestalten
Neuausrichtung der Versorgungsstrukturen: Thomas Reumann im Interview
19 Jan 2024
Dr. Johannes Leinert
Montage: © everythingpossible; alice_photo - stock.adobe.com

Digitale Transformation im Gesundheitswesen
Digitale Wende im Gesundheitswesen: Ferdinand Gerlach im Interview
12 Jan 2024
Jörg Artmann, Rosemarie Wehner

