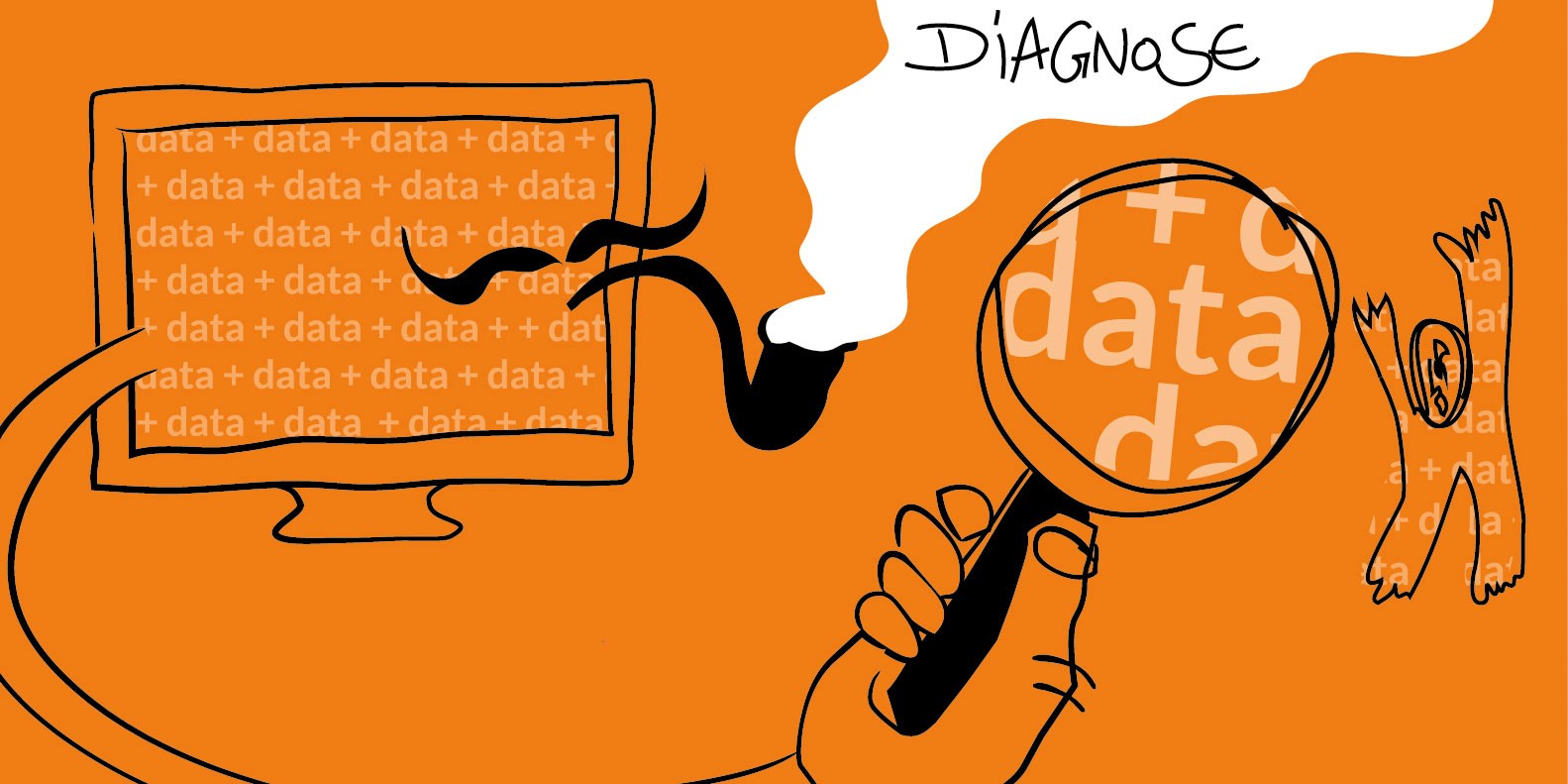„Der digitale Patient“ will sich in einer Debattenreihe den Möglichkeiten und Grenzen von Big Data im Gesundheitswesen konstruktiv nähern. Unser Blog fungiert dabei als Plattform, wir lassen hier Experten aus den verschieden Bereichen zu Wort kommen. Während Dr. Thilo Weichert im vorherigen Beitrag argumentiert hat, dass die Voraussetzungen für einen schadlosen Umgang mit persönlichen Gesundheitsdaten noch längst nicht gegeben sind, bloggt Dr. Silja Samerski darüber, wo die Möglichkeiten und Grenzen von Big Data für medizinische Entscheidungen liegen sollten.
Digitale Entscheidungshilfen gehören in Arztpraxen und Krankenhäusern bereits zum Alltag: Die Uniklinik Frankfurt hat beispielsweise Leitlinien in das Klinikinformationssystem integriert, und die Risikoprognose-Software arriba leitet den Hausarzt bei partizipativer Entscheidungsfindung an. Neue Computersysteme und Big Data versprechen jedoch noch mehr: IBM hat beispielsweise vor, den neuen Supercomputer Watson zum „kognitiven Assistenten“ aller Gesundheitsdienstleister zu machen – und zwar weltweit. Mit Zugriff auf riesige Mengen an Patientenakten, Fachartikeln, Protokollen usw. schlägt Watson Health innerhalb von Sekunden evidenzbasierte Diagnosen und Therapien vor, die nach statistischer Konfidenz gewichtet sind. Für seine Arbeit muss das elektronische Superhirn zunächst von Medizinern „trainiert“ werden, anschließend ist es selbstlernend. Die Algorithmen sind Betriebsgeheimnis von IBM; doch auch, wenn diese bekannt wären: selbstlernende Systeme verändern sich und sind dann selbst für Fachleute eine Black Box. Niemand kann wirklich nachvollziehen, wie und warum sie zu ihren Ergebnissen kommen. Trotz – oder gerade wegen – dieser komplexen Rechenleistung halten manche Experten den Computer für den besseren Arzt. Der Mathematiker Christian Hesse beispielsweise ist sich sicher: In Zukunft bestimmt die Software, wo es lang geht. Ärzte können „einpacken“, wie er in der Süddeutschen Zeitung schreibt, weil die Rechenmaschine der „Leibarzt von morgen“ wird.
Herkömmlicherweise beruhen Diagnosen und Behandlungsentscheidungen auf einem ärztlichen Urteil. Der Arzt stellt eine Krankheit fest, macht also eine „ist“-Aussage über die anwesende Patientin. Anschließend entscheidet er – de lege artis – über die angezeigte Therapie. Solche Entscheidungen haben immer eine ethische Dimension. Zum einen implizieren Krankheits- und Gesundheitsdefinitionen soziale Vorstellungen davon, was sein soll und nicht sein soll, was also als „gesund“ und was als „krank“ gilt. Zum anderen stellt sich in der Arztpraxis und am Krankenbett immer auch die Frage, was jetzt und hier, in dieser konkreten Situation für diesen einen Menschen gut und hilfreich ist.
Zwischen Daten und Menschen bleibt eine Kluft
Lassen sich solche vielschichtigen Entscheidungen automatisieren? Wie IT-Experten klarstellen, kann ein Rechner gar keine Diagnose stellen oder Therapieentscheidung treffen. Watson Health kalkuliert anhand von unzähligen Daten und mit Hilfe von verschiedenen statistischen Techniken Wahrscheinlichkeiten. Predictive analytics ist der Oberbegriff für diese Form der datengetriebenen statistischen Vorhersage. Voraussetzung für eine solche datenintensive Berechnung von dem, was heute sein und morgen werden könnte, ist es, Patienten nicht als Individuen, sondern als Mitglieder von statistischen Klassen zu behandeln – als gesichtslose Datenprofile. Auch, wenn diese Datenprofile sehr umfassend und daher „personalisiert“ sind: Zwischen der Statistik und dem Einzelfall, zwischen den kalkulierten Vorhersagen und der eigenen Biographie, zwischen den Daten und dem Menschen aus Fleisch und Blut bleibt eine Kluft. Supercomputer wie Watson Health können Informationen durchforsten, Muster erkennen, Wahrscheinlichkeiten kalkulieren und Möglichkeiten vorschlagen – einen leibhaftigen Menschen beurteilen und die Entscheidungen darüber treffen, was gut und richtig ist, das können sie jedoch nicht. Nicht nur, weil das Leben voller Überraschungen steckt, sondern auch, weil Statistiken keine „ist“-Aussage über ein Individuum machen können – auch nicht in Zeiten von Big Data.
Den Rechner als Helfer und nicht als „Leibarzt“ nutzen
Die Verlockung ist jedoch groß, die Verantwortung für Diagnose- und Behandlungsentscheidungen an den Rechner abzugeben. Bereits 90 Prozent aller onkologischen Pflegekräfte folgen den Vorgaben von Watson Health, berichtet IBM zufrieden. Kommen Ärzte und Pflegende in Zukunft unter Druck, wenn sie sich nicht nach dem Computer richten? Also doch eine automatisierte Medizin? Die große Herausforderung angesichts der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist es, den Rechner als Helfer zu nutzen und ihn nicht zum „Leibarzt“ und damit zum „Entscheider“ zu machen. Das setzt voraus, den fundamentalen Unterschied zwischen einem ärztlichem Urteil und einer statistischen Wahrscheinlichkeit nicht zu verwischen. Computer können blitzschnell Informationen zusammentragen und komplexe Korrelationen bewerten – die ärztliche Entscheidung ersetzen können sie jedoch nicht. Zumindest nicht dann, wenn das konkrete Individuum, der Mensch aus Fleisch und Blut, weiterhin der Ausgangspunkt ärztlichen Handelns sein soll.
Im nächsten Beitrag wird Prof. Martin Dugas über Dokumentationsformulare und Prozesse zur Abstimmung von Datenmodellen bloggen, um Big Data besser für die medizinische Forschung zugänglich zu machen.
Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter, um über neue Blog-Beiträge per E-Mail informiert zu werden.
Alle Artikel der Debattenreihe Big Data anzeigen